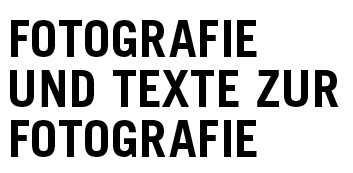Was passiert eigentlich, wenn man in der Landschaftsfotografie auf den trennenden und definierenden Horizont verzichtet? Man verliert die Orientierung. Und wird gezwungen, genau zu Schauen. Und in dem ein oder anderen Fall lohnt sich das sogar, wie das Museum Schloss Moyland am Niederrhein nun in einer kleinen, aber dennoch ganz schönen Ausstellung mit dem Titel „Landschaften ohne Horizont – Nah und Fern in der zeitgenössischen Fotografie“ zeigt. Bis zum 15. August sind Werke von 15 Künstlern zu sehen, die mitunter einen ganz eigenen Stil und/oder Technik entwickelt haben.
Wie zum Beispiel Andreas Gefeller. Für seine spektakulär unspektakulären Aufsichten steht die Kamera auf einem Stativ, dessen Fuß er sich gegen den Bauch stemmt. Auf diese Art „scannt“ er den Boden (oder wahlweise auch den Himmel) vor sich und setzt aus Hunderten Einzelaufnahmen ein Bild zusammen, das einen Blick wie aus einem Heißluftballon suggeriert, es aber definitiv nicht ist – denn alles, was höher als zwei Meter ist, verschwindet auf seinen vermeintlichen Luftbildern: Baumkronen zum Beispiel. Oder Decken von Wohnungen, so dass die Bilder aussehen wie architektonische Grundrisse – nur in real.
Ebenfalls sehr charakteristisch und innovativ für die Landschaftsfotografie sind die Bilder von Miklos Gaál. Mit seinen extremen Unschärfen der Großformatkamera wirken der urbane Raum und vor allem die Menschen darin wie Modelllandschaften. Umgekehrt ist es bei Thomas Wrede zu bestaunen: Er setzt Modelle von Häusern in die Landschaft, und Steine werden plötzliche zu riesigen Gebirgen – die eben noch schöne Natur bekommt etwas Bedrohliches, weil sich die Größenverhältnisse verschieben.
Interessant sind auch die Arbeiten von Walter Niedermayr und Timm Ulrichs: Während Niedermayr winzige Skifahrer in den schneebedeckten Bergen zeigt, präsentiert uns Ulrichs als einziger in der Ausstellung dann doch noch einen Horizont: Nur mit dem Unterschied, dass er gar keine Landschaft fotografiert, sondern lediglich das Ende eines belichteten Kleinbildfilmes verwendet hat: Die ausgefranste Kante wirkt stark vergrößert wie eine abstrakte Landschaft im Sonnenuntergang.
Durch und durch real sind hingegen die Aufnahmen von Daniel Gustav Cramer – seine Bilder von Wäldern aus der ganzen Welt sind klein und unauffällig, aber voller stiller Poesie und technisch einwandfrei. In der Ausstellung haben die mir vielleicht sogar am besten gefallen. Direkt danach kamen die Bilder von unterirdischen Steinaufwerfungen von Naoya Hatakeyama – in ihrer fast surrealen Romantik erinnerten sie mich an das „Eismeer“ Caspar David Friedrichs.
Einen Blick ins den Ausstellungskatalog sollte der Besucher übrigens auch werfen – allein schon deshalb, weil die Arbeit des Chinesen Zhao Liang meiner Meinung nach dort viel klarer und besser herüber kommt. Für die Ausstellung hat er seine Bilder von dreckigem Wasser auf Reispapier aufgezogen. Damit erinnern sie zwar an den Stil traditioneller chinesischer Landschaftsmalerei, allerdings säuft die Farbe auf dem Papier regelrecht ab und das eigentliche Bild ist mitunter nur sehr schwer zu erkennen. Da haben mich die Arbeiten seines Landsmannes Yao Lu, die ich auf der Paris Photo gesehen habe und die inhaltlich wie formell sehr ähnlich sind, deutlich mehr überzeugt.
- Andreas Gefeller, Ohne Titel (Rasen 1), 2002, Lightjetprint, Diasec, 152 x 125 cm © Andreas Gefeller, Courtesy Thomas Rehbein Galerie, Köln
- Naoya Hatakeyama, Ciel Tombé #4414, 2007, Lambda-Print, 49 x 100 cm © Naoya Hatakeyama, Courtesy Taka Ishii Gallery, Tokyo
- Thomas Wrede, Bergrutsch, 2005, Digital C-Print, Diasec, Ed. 5 + 2 AP, 180 x 150 cm © VG Bild-Kunst, Bonn 2010, Courtesy Galerie WAGNER + PARTNER, Berlin
- Zhao Liang, Water, 2006, Pigment-Print auf Reispapier, Ed. 6, 110 x 137,5 cm © Zhao Liang, Courtesy L.A. Galerie – Lothar Albrecht, Frankfurt am Main