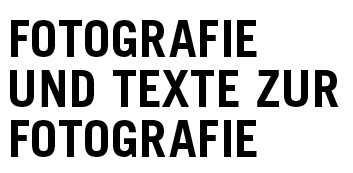Ich habe ja erst kürzlich das sehr persönliche Buch Easter and Oak Trees von Bertien van Manen vorgestellt. Nun kommt direkt ein weiteres hinterher: „Son“ von Christopher Anderson ist ebenfalls klein, intim, einfach und ohne viel Schnickschnack gestaltet. Allerdings hat der Magnum-Fotograf nicht in seiner Archivkiste gekramt, sondern er zeigt aktuelle Fotos. Entstanden sind sie in seiner Familie, die er mit der Geburt seines Sohnes ebenfalls zu fotografieren begonnen hat. Gleichzeitig geschieht auch eine Auseinandersetzung in seiner eigenen Rolle als Sohn, indem er auch seinen mittlerweile erkrankten Vater fotografiert. Das Buch wirkt deshalb ein wenig wie eine Mischung aus „Letzte Tage mit meinem Vater“ von Phillip Toledano, „Closer“ und „Recent“ von Elinor Carucci und „Sommerherz“ von Thekla Ehling – und das alles oftmals gepaart mit Andersons ganz besonderem Umgang mit dem (Gegen)Licht, die seine Bilder regelrecht magisch und fast wie für Modeaufnahmen inszeniert erscheinen lassen, und was mit dem goldenen Vorsatzpapier auch gestalterisch aufgegriffen wird.
Das Buch kommt zudem fast komplett ohne Text aus. Lediglich am Ende erklärt Anderson selbst kurz in einem Statement, dass er sein gesamtes fotografisches Leben lang weit gereist ist, um die Erfahrungen von Fremden zu fotografieren. „Vielleicht habe ich gehofft, etwas über mich selbst zu verstehen, wenn ich Zeuge werde bei intimen Momenten von Menschen, die ich nicht kenne.“
Ein wenig verwunderlich finde ich, dass Anderson niemals damit gerechnet hat, dass seine Privatfotos irgendetwas mit seinen „Arbeiten“ zu tun haben könnten – bei einem Magnum-Fotografen habe ich ein wenig mehr Selbstreflexion erwartet. „Ich begann zu verstehen, dass alles, was ich zuvor fotografiert habe, bloß eine Vorbereitung war, um diese Fotos zu machen. Diese Fotos kann man nicht von meiner Arbeit trennen … they were my most important life work.“ Für Anderson sind diese Bilder deshalb weder eine Dokumentation noch eine Erzählung noch Kunst. „They are declarations of love…“
Auffällig finde ich übrigens die Häufung von Fotos, die vor großen Fenster- und Glasflächen entstehen. Manchmal dienen sie als Großstadtkulisse im Hintergrund, dann wieder als trennendes oder auch als verbindendes Element zwischen Innen und Außen, zwischen der Familie und dem Rest der Welt. Und gegen Ende des Buches fotografiert Anderson eine Haustür von außen, durch deren Glasscheibe man eigentlich in das dunkle Innere schauen würde. Können wir aber nicht, denn die Spiegelung zeigt uns den grünen Garten, der außerhalb unseres Blickfeldes liegt und der wie durch Geisterhand plötzlich im Inneren des Hauses aufzutauchen scheint. Das steht dann im krassen Gegensatz zum Cover-Motiv, auf dem wir seinen Sohn und seine Frau (?) unter der Dusche sehen. Sie sind ihm ganz nah und wirken doch unerreichbar, weil die Glasscheibe von den Wassertropfen fast undurchsichtig wird. Die kleinen Handflächen, die sein Sohn gegen die Scheibe presst, lassen die Distanz zwischen ihnen noch unerreichbarer erscheinen.
Link: Kehrer